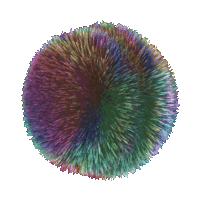Gut aufgearbeitet aber nicht viel neues?
Laura Wiesböck erforscht in ihrem Buch die Darstellung und Inszenierung psychischer Erkrankungen in den sozialen Medien. Sie verdeutlicht, dass Begriffe wie "Trauma" und "toxisch" übermäßig verwendet werden, was sowohl zur Entstigmatisierung als auch zur Romantisierung psychischer Probleme führt. Diese Tendenzen bieten Identifikationsmuster, die beruhigend wirken können, bergen jedoch auch die Gefahr, dass jede emotionale Abweichung pathologisiert wird.
Wiesböck kritisiert, dass diese Entwicklung nicht nur von einem ernsthaften Umgang mit psychischen Themen getrieben ist, sondern auch von wirtschaftlichen Interessen, insbesondere durch Influencer, die Wellness-Produkte bewerben. Sie argumentiert, dass die individuelle Suche nach Wohlbefinden im neoliberalen Kapitalismus dazu beiträgt, schwierige Arbeitsbedingungen erträglicher zu machen, anstatt sie in Frage zu stellen.
Das Buch konzentriert sich auf gesellschaftliche Aspekte und kritisiert den neoliberalen Kapitalismus, wobei Wiesböck auch auf die Rolle von Individualisierung und sozialer Isolation hinweist. Trotz ihrer umfassenden Analyse bleiben einige Deutungsperspektiven unberücksichtigt, wie etwa die Rolle von Nachbardisziplinen oder gesellschaftlich bedingte Gründe für die Annahme neuer Deutungsmuster.
Wiesböck kritisiert, dass diese Entwicklung nicht nur von einem ernsthaften Umgang mit psychischen Themen getrieben ist, sondern auch von wirtschaftlichen Interessen, insbesondere durch Influencer, die Wellness-Produkte bewerben. Sie argumentiert, dass die individuelle Suche nach Wohlbefinden im neoliberalen Kapitalismus dazu beiträgt, schwierige Arbeitsbedingungen erträglicher zu machen, anstatt sie in Frage zu stellen.
Das Buch konzentriert sich auf gesellschaftliche Aspekte und kritisiert den neoliberalen Kapitalismus, wobei Wiesböck auch auf die Rolle von Individualisierung und sozialer Isolation hinweist. Trotz ihrer umfassenden Analyse bleiben einige Deutungsperspektiven unberücksichtigt, wie etwa die Rolle von Nachbardisziplinen oder gesellschaftlich bedingte Gründe für die Annahme neuer Deutungsmuster.